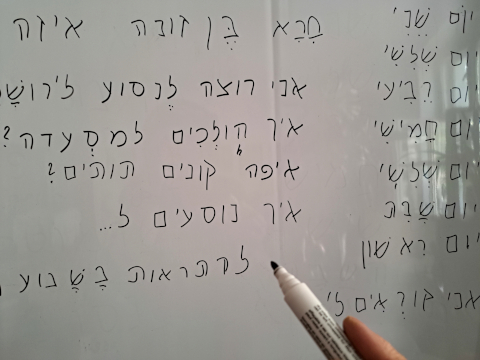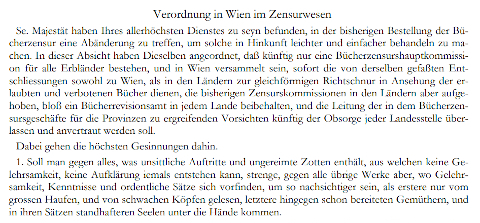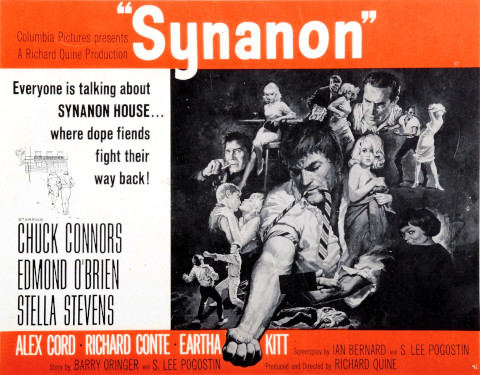– Aus meinem Buch Heroin – Sucht ohne Ausweg? (1993)
Das deutsche System der Drogenberatung hat eine merkwürdige Eigenart: Es erreicht nur einen geringen Prozentsatz der Adressaten. Nur ein knappes Viertel aller Heroin-Abhängigen, von den gelegentlichen Konsumenten ganz zu schweigen, taucht freiwillig in einer Drogenberatungsstelle auf. Die Klienten sind nicht selten enttäuscht von dem, was ihnen geboten wird: Die meisten kommen einmal, dann nie wieder. Offenbar nicht zufällig gibt es kaum Untersuchungen, die sich damit beschäftigen, ob Heroin-Abhängige die gängige Beratung akzeptieren. Trotzdem behaupten gutmeinende Drogenexperten immer wieder, das Beratungsangebot sei unzureichend und müsse ausgebaut werden.

Credit: File:Microcosm of London Plate 096 – Workhouse, St James’s Parish.jpg | Thomas Rowlandson (1756–1827) and Augustus Charles Pugin (1762–1832) (after) John Bluck (fl. 1791–1819), Joseph Constantine Stadler (fl. 1780–1812), Thomas Sutherland (1785–1838), J. Hill, and Harraden (aquatint engravers)
Nur einzelne Stimmen werden laut, die das System als Ganzes in Frage stellen. Der Kieler Arzt Gorm Grimm: «Insgesamt gesehen schaden die Drogenberatungsstellen mehr, als dass sie nützen.» Grimm hat anhand der Zahlen des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie in München errechnet – dort melden die meisten Drogenberatungsstellen, wie viele Klienten sie hatten und was mit denen geschehen ist -, dass die «Erfolgsquote» bei maximal 0,5 Prozent liege.
Insgesamt gesehen schaden die Drogenberatungsstellen mehr, als dass sie nützen.
Das hat seine Gründe, die zwar alle kennen, über die aber ungern geredet wird. Die ersten Drogenberatungsstellen richteten die freien Wohlfahrtsverbände in den siebziger Jahren ein, analog zu den Alkoholberatungsstellen. Die Behandlung der Sucht war bis dato Aufgabe der Mediziner oder der Psychiater gewesen. Die jedoch hatten kläglich versagt: Die Skepsis der Ärzte gegenüber der Drogensubkultur und deren Selbstverständnis führte eher dazu, dass die jugendlichen Konsumenten einen großen Bogen um Krankenhäuser und psychiatrische Kliniken machten, die eine «Entgiftung» anboten. Selbst einer der deutschen Abstinenz-Päpste, der ehemalige Berliner Landesdrogenbeauftragte Wolfgang Heckmann, gab zu, dass «spätestens ab 1973 die Bankrotterklärung für die Behandlungen in [psychiatrischen] Einrichtungen jedenfalls fachöffentlich war». (1)
Drogenabhängigkeit, so urteilten Fachleute Anfang der achtziger Jahre, sei nämlich nicht nur ein rein medizinisches Problem, sondern «in nahezu allen Fällen» die Folge von «subjektiver, sozialer und psychischer Misere», wobei «die soziale Misere die psychische Misere bedingt und nicht umgekehrt». Deshalb wurden für die Rehabilitation zusätzlich andere Berufsgruppen eingespannt. Das Bundessozialgericht urteilte 1982: «Die Begriffe der medizinischen Rehabilitation und der Krankenhilfe erfassen auch die Leistungen von Sozialarbeit und Sozialpädagogik», die «ärztliche Behandlung ist nur ein Unterfall des Hauptfalles medizinischer Leistung. Diese erfordert jedoch nicht die stetige Mitwirkung des Arztes.»

Arbeitshaus in Mitcham/London, 19. oder frühes 20. Jh.
Die einzigen, die immer in direktem Kontakt mit der Drogen-Subkultur gestanden hatten, waren die Fürsorger, eine Bezeichnung, die heute fast verschwunden ist. Dieser Berufsstand hatte sich seit 1970 gewandelt: Voraussetzung war jetzt Abitur oder Fachabitur, die Absolventen der Ausbildung nannten sich Sozialarbeiter.
Damit gerieten sie in Konkurrenz zu anderen Gruppen, die sich auch für die Behandlung von Drogenabhängigen zuständig fühlten, den Soziologen, Psychologen und Pädagogen. Jede dieser Expertengruppen trug ihr Scherflein dazu bei, warum und wie man der «Drogenwelle» begegnen könne. Die Sozialarbeiter fühlten sich als die, die die «Dreckarbeit» machten. Diese unbequeme Tätigkeit war aber meistens die eigentliche Hilfe für die Klienten. Viele Sozialarbeiter bildeten sich fort, um einen «therapeutenähnlichen Status» zu erlangen. Die Kompetenz für eine Drogenberatung konnte, genau wie heute, nicht durch eine Ausbildung erworben werden, sondern nur durch die Praxis: learning by doing. Es gibt keinen Beruf «Drogenberater». Auf diesem Feld konkurrieren und profilieren sich allerlei Berufsgruppen, von denen jede einzelne genau zu wissen vorgibt, wie man mit Drogenabhängigen zu verfahren habe. Dementsprechend waren und sind die Ergebnisse.
Es gibt keinen Beruf «Drogenberater.
Schon vor zwanzig Jahren klagten alle, die sich mit Drogenkonsumenten plagen mussten, über deren mangelnde Motivation. Die Bereitschaft zu einer Therapie, an deren Ende die Drogenfreiheit stehen sollte, war gleich null. Da niemand wusste, wo die auslösenden Faktoren für die «Sucht» zu suchen waren und worin sie bestanden, kam man auf den Gedanken, vorbeugend zu arbeiten. Je früher man «den Gefährdeten» aufspüre, desto eher könne man ihm helfen, so die Idee. Die Drogenberater wurden angewiesen, die potentiellen Klienten, die vielleicht irgendwann einmal Drogen probieren würden, dort aufzusuchen, wo sie sich «außerhalb der Familie» aufhielten. Auch das ging schief. Die Jugendlichen – auch die ohne Drogenprobleme – hatten Jugend-, Sozial- und Gesundheitsämter eher als repressive Behörden erlebt und weigerten sich standhaft, mit diesen Institutionen zu kooperieren.
Noch bis 1972 waren die Drogenberater von den Klienten äußerlich nur wenig zu unterscheiden: Das Mobiliar der Beratungsstellen entstammte häufig dem Sperrmüll, und theoretische Grundlagen der Arbeit waren so gut wie nicht vorhanden. Jeder wurschtelte vor sich hin, so gut es ging. Das sollte sich ändern – was das äußere Erscheinungsbild betraf -, als Geld ins Spiel kam.

Arbeitshaus in Irland, 19. oder frühes 20. Jh.
1973 vergab der Bundesminister für Jugend, Familie und Gesundheit ein Forschungsprojekt an das Max-Planck-Institut für soziale Psychiatrie in München. Die Experten sollten herausfinden, welchen Mindestanforderungen eine Drogenberatungsstelle zu genügen hatte, um in den Genuss öffentlicher Gelder zu kommen. Diese Kriterien bezogen sich sowohl auf die Inhalte der Arbeit als auch auf die formale Struktur. Vorschrift wurden: schriftliche Unterlagen über das Konzept und periodische Berichte, Dokumentation der Maßnahmen (u. a. die sogenannten «Krankengeschichten»), tägliche Öffnung, zwei anwesende Mitarbeiter, von denen’einer hauptamtlich Arzt, Psychologe oder Sozialarbeiter sein musste, ein «Therapieraum», mindestens eine Fallbesprechung pro Woche und gelegentliche externe Kontrolle. Diese Vorschriften wurden bis heute mehrfach modifiziert, im Kern sind sie jedoch noch gültig. Offiziell hießen die Drogenberatungsstellen jetzt «Psychosoziale Beratungs- und ambulante Behandlungseinrichtung für Suchtkranke und Suchtgefährdete».
Wer sich dem alleinseligmachenden Glaubenssatz, dass nur die Abstinenz anzustreben sei, widersetzte, bekam Ärger. Man ging für das Dogma über Leichen.
Wer sich diesen Kriterien verweigerte, wurde finanziell ausgeblutet. Durch die Konkurrenz um die Staatsknete gingen diejenigen Einrichtungen als Sieger hervor, die sich, was den Inhalt ihrer Arbeit anging, gefügig zeigten. In vielen Städten kam es zu Konflikten zwischen den Behörden und den Beratungsstellen, die andere Vorstellungen über ihre Aufgaben hatten. In Berlin zum Beispiel schlossen Mitte der achtziger Jahre mehrere Einrichtungen aus Protest gegen die staatliche Einflussnahme ihre Pforten. Wer sich dem alleinseligmachenden Glaubenssatz, dass nur die Abstinenz anzustreben sei, widersetzte, bekam Ärger. Die Behörden scheuten sich zum Teil nicht, Mitarbeitern von niedrigschwelligen Angeboten per Dienstanweisung zu verbieten, sterile Einwegspritzen an die Junkies zu verteilen – das sei «suchtverlängernd» -, obwohl die Gefahr, sich mit dem HIV-Virus zu infizieren, immer größer wurde. Man ging für das Dogma über Leichen.
Wenige Jahre, nachdem die Mindestanforderungen formuliert worden waren, war genau das eingetreten, was die Gründer der Drogenberatungsstellen ursprünglich verhindern wollten; es hatten sich Institutionen entwickelt, die in den Augen der Junkies mit Behörden gleichgesetzt und daher auch nicht akzeptiert wurden.

Die Gartenlaube, 1857
Die wesentliche Aufgabe der Drogenberatungsstellen sollte sein (und ist es noch), den Drogenabhängigen entweder einen Platz im Krankenhaus zu vermitteln, wo sie entziehen können, oder/und sie einer Therapie-Einrichtung zuzuführen. Beides dauert in der Regel mehrere Wochen – bis ein Platz gefunden ist. Kompliziert ist auch die finanzielle Frage, da die «Entgiftung» normalerweise von den Krankenkassen bezahlt wird, die Rehabilitation, also die Therapie, jedoch von den Rentenversicherungen. Viele der verelendeten Junkies sind überhaupt nicht versichert, daher muss das Sozialamt einspringen. Heute [1993] kommt hinzu, dass auch die obligatorische «psychosoziale Betreuung» von Polamidon-Substituierten übernommen werden soll. Viele Einrichtungen sind zwar plötzlich gut besucht, aber mit dieser Aufgabe überlastet und weigern sich, Junkies neu aufzunehmen, was die von einigen wenigen einsichtigen Politikern geforderte Ausweitung der Polamidon-Programme konterkariert.
In Nordrhein-Westfalen hatte man das Dilemma erkannt, dass sich bei mehrmonatigen Wartezeiten die Motivation der Fixer, sich um einen Therapieplatz zu bemühen, nicht gerade erhöht. Deshalb initiierte man 1992 das Programm «Therapie sofort»: Jeder Heroinabhängige sollte innerhalb einer Woche eingewiesen werden können, falls er das wünschte. Zunächst war der Andrang stark. Die Medien berichteten mit großem Getöse über die Junkies, die doch bisher als behandlungsunwillig galten. Mittlerweile ist die Resonanz in der Szene abgeflacht. Die Suchtexperten sind kleinlaut geworden. Man hatte nämlich das wesentliche Problem nicht bedacht: Therapie-Einrichtungen haben keinen oder nur sehr geringen Erfolg.
Therapie-Einrichtungen haben keinen oder nur sehr geringen Erfolg.
Kaum jemand hat bisher den Mut gefunden, das offen auszusprechen. Journalisten, die zum Thema recherchierten, ließen und lassen – sich in der Regel von der Selbstdarstellung der betreffenden Einrichtung blenden. Kritische Stimmen wurden seitens der Betreiber der Drogentherapien eingeschüchtert, ja mit Klagen bedroht. Nur im «Spiegel-Spezial Rauschgift» aus dem Jahr 1989 war zu lesen: «Es gibt keine Drogentherapie, die diesen Namen verdient – sie taugen alle gleichermaßen wenig (oder nichts).»
Das war zwar schon immer so, Drogentherapie gilt jedoch in der öffentlichen Meinung als die einzige Methode, mit dem Problem fertig zu werden. Die Junkies, die schon einmal das zweifelhafte Vergnügen hatten, mit therapeutischen Maßnahmen beglückt zu werden, die ein drogenfreies Leben zum Ziel hatten, wussten das besser. Warum sollte ein Heroin-Abhängiger also freiwillig etwas aufsuchen, was nichts nützt?
Die Hälfte aller Junkies, die eine Therapie-Einrichtung von innen gesehen haben, leugnen deren Einfluss auf ihren persönlichen Umgang mit Drogen; nur zehn Prozent der anderen Hälfte (also fünf Prozent von allen) gaben bei Umfragen an, ihr Drogenverhalten habe sich durch eine Therapie geändert. Ähnlich, wenn nicht gar noch schlechter, sieht die Erfolgsquote der Therapien insgesamt aus. Nur gut ein (!) Prozent aller Fixer wird in stationären Einrichtungen «erfolgreich im Sinne dauerhafter Drogenabstinenz und gelungener Reintegration behandelt». (2)

Gruppentherapie (Symbolbild)
Natürlich lässt sich über diese Zahl streiten. Die Diskussion wird aber durch zwei Dinge erschwert: Niemand weiß, was als «Erfolg» zu werten ist, und keine der deutschen Drogentherapie-Einrichtungen hat bisher zugelassen, dass die hausgemachte Statistik extern von unabhängigen Fachleuten überprüft werden konnte — ein Zufall?
Kriterium für Drogenfreiheit ist, so der offizielle Konsens: Nur einmal in drei Monaten Konsum illegaler Drogen, also auch von Haschisch, pro Monat höchstens dreimal stärkerer Alkoholkonsum, keinerlei Kontakte zur Szene. (3) Dieses Prinzip ist selbst für diejenigen, die dem Konzept einer Therapie wohlwollend gegenüberstehen, abstrus und absurd. Da ein relevanter Teil der Bevölkerung zumindest gelegentlich Cannabis-Produkte konsumiert — in den deutschen Großstädten ist Haschisch faktisch legalisiert—, erfüllt diese hohen Voraussetzungen kaum jemand, den Autor eingeschlossen.
Fast alle Heroinabhängigen werden nach einer Therapie wieder rückfällig.
Fast alle Heroinabhängigen werden nach einer Therapie wieder rückfällig. Die Therapeuten mussten diese Tatsache zumindest in ihr Denksystem integrieren. Man durfte Drogentherapie nicht an sich in Frage stellen, weil das ja gleichzeitig den Verlust des Arbeitsplatzes zur Folge gehabt hätte. Deshalb wurde die Devise ausgegeben, Abbruche seien «normal» und auch zu erwarten. Drogenabhängigkeit sei «von vielen Brüchen, Rückschlägen, erneuten Anläufen und erneuten Rückschlägen gekennzeichnet». (4) Aber je häufiger ein Junkie in einer Drogentherapie verweile, um so wahrscheinlicher werde, dass das Ziel – die völlige Drogenfreiheit – am Horizont auftauche. Diese kühne Theorie wird leider durch die Realität nicht bestätigt. Die Zahl der Entzüge in Eigenregie nimmt auffällig zu, die Therapiebereitschaft ab.
Deshalb operiert die Abstinenz- und Therapie-Lobby mit einem Verbundsystem, das alle Institutionen umfasst, die Druck auf die Drogenkonsumenten ausüben können: Drogenberatungsstellen, Polizei, Justiz und nicht zuletzt die Therapie-Einrichtungen. Der Drogenabhängige soll den helfenden Maßnahmen und dem Quasi-Monopol der Abstinenz-Therapien nicht entwischen können. «Wichtig ist bei allen Hilfsmaßnahmen, dass immer dann, wenn eine Maßnahme auf einer höheren Stufe fehlschlägt, der betreffende Abhängige auf der niedrigeren Stufe der Rehabilitation und Motivation wieder aufgefangen wird, dem Netz der Hilfsmaßnahmen, dem Verbundsystem folglich nicht völlig entgleitet.» (5) Der Süchtige ist nämlich gefährdet – sprich: süchtig -, solange er lebt, und muss, so er nicht willig ist, Drogen und die Szene zu meiden, lebenslang therapiert werden, ob er will oder nicht.
Ein großer Teil der Therapie-Insassen, in manchen Einrichtungen mehr als die Hälfte, ist nicht freiwillig dort, sondern nach einer Verhaftung wegen Vergehens gegen das
Betäubungsmittelgesetz – durch den Richter vor die Alternative gestellt worden: Therapie oder Gefängnis (nach dem berüchtigten Paragraphen 35 im Betäubungsmittelgesetz). Da Drogenabhängige scheinbar nicht motiviert seien, müsse «sanfter» Zwang ausgeübt werden, um die Bereitschaft zur Therapie zu erhöhen. Der sieht in der Realität so aus, dass bei Bewährungsstrafen unter einem Jahr mit der Auflage, sich einer Abstinenz-Therapie zu unterziehen, die Bewährung häufig genug widerrufen wird, weil es den Junkies nicht gelingt, clean zu bleiben. Strafen über einem Jahr werden ohnehin nur sehr selten auf Bewährung ausgesprochen. Gorm Grimm behauptet sogar: «Ohne Strafandrohungen für Therapie-Abbruche würden diesen deutschen Einrichtungen nahezu 100% der Klienten davonlaufen.» (6)

Zuchthäuslerinnen bei der Hanf-Verarbeitung im Bridewell Prison in London (William Hogarth, 1732)
Bricht ein Junkie eine Zwangstherapie ab, muss die Einrichtung das an die Justiz melden, deren Mühlen beim Thema Drogen in der Regel recht zügig mahlen – es wird dann ein Haftbefehl ausgestellt. Die Einrichtungen haben sogar das Recht, ihre Insassen bei Fehlverhalten jederzeit auf die Straße zu setzen, was dazu führt, dass die entweder freiwillig ins Gefängnis gehen oder warten, bis die Polizei sie wieder aufgreift.
Sebastian Scheerer will die gängige Praxis der deutschen Justiz, den Grundsatz des Gesetzes «Therapie vor Strafe» (7) möglichst zu verhindern und nur in – geschätzt – einem knappen Drittel aller Fälle überhaupt eine Therapie zu ermöglichen, nur deshalb nicht einen «Skandal» nennen, weil er um die «Trostlosigkeit der tatsächlich angebotenen ‘Therapien’ und ihre möglicherweise noch schädlicheren Auswirkungen» weiß.
Kritiker der Drogentherapien halten diese für «totalitäre Institutionen», die «einige unübersehbare Ähnlichkeiten mit Konzentrationslagern und politischen Umerziehungsanstalten aufweisen». (8) Die Insassen haben weniger Rechte als in Gefängnissen, Postzensur, Verbot jeglicher Außenkontakte in der Anfangszeit und demütigende Rituale der Entmündigung sind an der Tagesordnung. Ein kompliziertes Strafsystem sorgt für Ordnung, willige Ex-Junkies werden als «Kapos» eingesetzt und wachen über die Einhaltung der Anstaltsregeln. Für die Junkies, so die Kritik, gehe es nur ums Überleben, ihre Mitarbeit sei «reine Heuchelei».
Arbeit macht drogenfrei.
Wenn man den – in der Regel wissenschaftlich nicht begründeten – gruppendynamischen Firlefanz außer acht lässt, bleibt von der Praxis der «Drogentherapie» ein Skelett von Maßnahmen übrig, das sich nur unwesentlich vom klassischen «Arbeitshaus» unterscheidet: Arbeit macht drogenfrei.
Das gilt häufig auch für die Einrichtungen, die sich als «Selbsthilfeprojekte», manchmal verschämt, aber treffender als «Laientherapie» deklarieren. So auch für den Prototyp «Synanon», der auf den Anspruch, eine Therapie zu sein, ganz verzichtet hat und sich selbst – weit umfassender -eine «Lebensform» nennt. Dabei klingt der Grundgedanke der Einrichtung zunächst plausibel: Die Gründer von Synanon weigerten sich, ihre Drogenabhängigkeit als Krankheit zu sehen, die nur mit fremder Hilfe zu bewältigen sei. Von der klassischen Medizin erwarteten sie nicht viel. Trotzdem wollten sie sich mit ihrer Lage nicht abfinden.
So gründete sich schon 1958 in den USA eine Selbsthilfegruppe nach dem Vorbild der «Anonymen Alkoholiker». Ihr Initiator, Chuck Dederich, schuf Wohngemeinschaften, die ohne Suchtmittel, ohne Gewalt, ohne Profit und ohne Privateigentum auskommen wollten. Heutige AbstinenzPhilosophen sprechen schwärmerisch davon, dass in diesen USamerikanischen Synanon-Häusern «das frühere Leben auf der Scene keine Bedeutung» mehr hatte, «sondern nur die Gegenwart des Lebens und Arbeitens in der Gemeinschaft». (9) Nach diesem Vorbild gründete sich 1964 «Day-Top», 1967 das Projekt «Phoenix House». Im gleichen Jahr entstand in England die «Release»-Bewegung, die sich ähnlichen Zielen verschrieb.
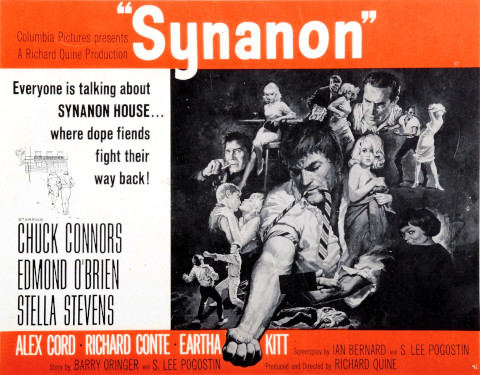
Synanon (1965)
Der US-amerikanische Zweig von Synanon geriet bald in die Schlagzeilen der Presse. Chuck Dederich entwickelte sich zu einem größenwahnsinnigen Guru, der seine «Drogentherapie» zu einer sektenähnlichen Organisation ausbaute. Erst als sich ein Gericht für seine Praktiken interessierte, wurde ihm das Handwerk gelegt. Dederich wurde verurteilt, weil er versucht hatte, einen Rechtsanwalt mit einer Klapperschlange zu ermorden. Der deutsche Zweig von Synanon distanzierte sich von der Mutterorganisation. Ingo Warnke, einer der Gründer von Synanon in Deutschland, über Dederich: «Ich habe viel von ihm gelernt. Doch heute dreht er durch.»
Anfang der siebziger Jahre gab es ein breites Angebot von «therapeutischen Wohngemeinschaften», deren soziologisches Outfit sich kaum von dem der Drogenszene unterschied. Die Ex-Junkies wurden kaum betreut, die Fluktuation war hoch, und eine große Anzahl der Gruppen stand permanent vor der Auflösung. Der Trend ging daher in die Richtung, die heute vor allem Synanon und Day-Top verkörpern: Härte, Härte und nochmals Härte, Arbeit und radikale Ablehnung der gesamten Lebensverhältnisse und der Subkultur der Abhängigen. Die eher libertinär ausgerichtete «Release»-Bewegung ist so gut wie verschwunden.
Übriggeblieben sind die Einrichtungen, die sich an den Idealen der protestantischen Arbeitsethik orientieren und Disziplin, Selbstbeherrschung und Askese propagieren. Diese Ziele finden in Deutschland selbstredend eine starke Lobby, schon aus Gründen der kulturellen Tradition. Die drogenfreien Selbsthilfe-Therapien bewirken aber kaum mehr als die klassische, psychotherapeutisch ausgerichtete Drogentherapie, als deren Kritiker sie ursprünglich angetreten waren.
Kern der Synanon-Methode ist eine verbale «Angriffstherapie», die verniedlichend das «Spiel» oder «game» genannt wird. Die Junkies müssen ihren Charakter, ihr Verhalten und ihr bisheriges Leben radikal in Frage stellen lassen. Jeder bekennt sich, dass er sein Leben lang «süchtig» sein wird, also gezeichnet ist. Durch diese Gehirnwäsche soll die «wahre Person» zum Vorschein kommen, die «Maske», hinter der sich ein Drogen-Konsument verberge, zerstört werden. Das Gefühl, allein nichts zuwege zu bringen, wird durch die Identifikation mit der Gruppe ersetzt.
Selbst Wissenschaftler, die diesem Experiment neutral gegenüberstehen, urteilen: Entsprechend dieser Gruppenidentität wird das Mitglied von Synanon nach seiner erfolgreichen Umfunktionierung die Gemeinschaft von Synanon nur ungern verlassen, da er Befriedigung und Sicherheit ausschließlich in dieser Gemeinschaft findet.» Ein Motiv für den Junkie, bei Synanon zu bleiben, liege darin, dass er nur dort Status und Einkommen bekomme, was ihm in der «anderen Welt» wegen «deren Vorurteile, seiner kriminellen Vorgeschichte und auch wegen seiner mangelnden Qualifikation» nicht möglich sei. Synanon demonstriere, dass die Therapie in geschlossenen Einrichtungen häufig nur zum Leben in diesem geschützten Milieu befähige. (10)
Wissenschaftliche Erhebungen, ob dieser Ansatz den Drogenabhängigen helfen könnte, wurden von Synanon mit der Begründung abgelehnt, «die Patienten würden sich durch Erhebungen als Anstaltsinsassen fühlen». (11) Die Hälfte der Insassen verlässt in den ersten drei Monaten die Einrichtung. Ehemalige Mitglieder von Synanon schätzen, dass von den rund 1000 Aufnahmen pro Jahr nur ein Dutzend Drogenabhängige mehr als zwei Jahre durchhält. Synanon selbst kann einen «Erfolg» — die dauerhafte Abstinenz nicht mit Zahlen belegen – oder will es nicht.
Die therapeutischen Wohngemeinschaften, die sich heute zu rigide organisierten und finanzkräftigen Institutionen entwickelt haben, sind ein uneheliches Kind der Studentenrevolte Ende der sechziger Jahre. «Der theoretische Ausgangspunkt der Selbsthilfe», schreibt Horst Brömer, «ist die These der gesellschaftlichen Determination der Persönlichkeit des Jugendlichen.» (12) Die Umwelt sei an der Drogensucht schuld, und wenn man nur wolle, könne man das ändern. Konsequent wird das «süchtige» Verhalten von der Subkultur und deren Werten abgeleitet, die die Drogen-Konsumenten prägten. Eine Prägung durch charakterliche Defekte, wie sie die Psychiatrie bei der Drogensucht annahm, lehnt man ab. Jeder fühlt sich sowohl als Therapeut wie als Patient.

AntiDrogen-Therapie in China, credits: China Daily
Diese Prämissen entsprechen ungefähr denen des lerntheoretischen Ansatzes zur Erklärung der Drogensucht. Nicht der Konsum einer Droge sei das Wesentliche, sondern die Subkultur, in der es soziales Prestige bringt, «cool» zu sein und mit dem gefährlichen Stoff umgehen zu können. Deshalb müsse die Subkultur durch etwas anderes ersetzt werden. «Die strukturierende Kraft der Drogenszene», die den Fixer entweder cool oder hilfsbedürftig erscheinen lasse, werde «durch die strukturierende Kraft der Wohngruppe ersetzt».
Ein Mittel dieser «Kraft» ist zum Beispiel der Initiationsritus der Aufnahme, der häufig an exorzistische Rituale erinnert: Der Neuankömmling muss alle Dinge, die an die Szene erinnern – wie Kleidung, Schmuck usw. – ablegen, bekennen wie ein reuiger Sünder, dass er schuldig und sein bisheriges Leben verfehlt ist, und Besserung und Mitarbeit schwören. Wie absurd diese Praxis ist, wenn jemand nur vor den Toren einer Drogentherapie erscheint, um dem Gefängnis zu entgehen, scheint einleuchtend. Drogentherapien, die ursprünglich die «Sucht» in Selbsthilfe bekämpfen wollten, indem sie auf lebenslange Abstinenz setzten, können zwar bei denen etwas bewirken, die sich freiwillig dieser Tortur unterziehen, in dem Wissen um das, was sie erwartet. Als allgemeingültiges Modell, wie man Abhängigkeit von psychothropen Substanzen «heilen» könnte, sind sie jedoch genauso gescheitert wie diejenigen Einrichtungen, die immer noch davon ausgehen, der Patient müsse von charakterlichen Defiziten befreit werden.
Das deutsche System der Zwangstherapie steht in Europa beinahe einzigartig da.
Das deutsche System der Zwangstherapie steht in Europa beinahe einzigartig da. In fast allen anderen europäischen Ländern ist Freiwilligkeit oberster Grundsatz bei der Behandlung OpiatAbhängiger. Erschwert wird die Situation der Junkies in Deutschland noch dadurch, dass medika-mentengestützte Therapien, wie zum Beispiel die Substitution mit Codein oder Polamidon, viel seltener angeboten werden. Der Berliner Gerichtsmediziner Prof. Friedrich Bschor: «Der Gedanke liegt nahe, das deutsche Drogenfreiheits-Paradigma eher in der Nähe sybillinischer Kultvorschriften denn im Bereich empirischer Wissenschaft zu vermuten.» (13) Der einzige Erfolg dieser Kultvorschrift: Ein großer Teil der jugendlichen Drogenkonsumenten kommt mit dem Gesetz in Konflikt, wird vorbestraft und hat sich die Zukunft verbaut. Ein gegen die Jugend ist in vollem Gange, aber schon verloren: Die Zahl der Heroin-Abhängigen steigt immer mehr an, trotz aller repressiver Maßnahmen.
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einer Justizvollzugsanstalt wandten sich 1992 mit einem verzweifelten Brief an die Öffentlichkeit: «Die vergangenen zwanzig Jahre des Vorrangs der Abstinenztherapie haben im Ergebnis dazu geführt, dass die Zahl der Drogenabhängigen weiter steigt, die Therapieeinrichtungen eine extrem niedrige Erfolgsquote aufweisen, die Verelendung in der Drogenszene weiter zunimmt und sich die Justizvollzugsanstalten zunehmend mit Drogenabhängigen füllen. In Vollzugsanstalten niedriger Sicherheitsstufe sitzen heute bereits mehr Drogenkonsumenten ein als wegen klassischer Eigentumsdelikte (wie Diebstahl) Verurteilte. Rechnet man hinzu, dass sich hinter vielen Verurteilungen wegen Eigentumsdelikten Beschaffungskriminalität von Drogengebrauchern verbirgt, dann gibt es bereits jetzt Anstalten, in denen mehrheitlich Drogenkonsumenten ‘zwischengeparkt’ werden.» (14)
(Fortsetzung: Therapie – eine unendliche Geschichte II
_____________________________________________
(1) Zit. nach G. Grimm (1985), S. 57
(2) ebd., S. 60f, dort auch andere Literatur
(3) G. Bühringer: Standards für die Durchführung von Katamnesen bei Abhängigen: Ergebnisse einer Arbeitsgruppe der Deutschen Gesellschaft für Suchtforschung und Suchttherapie, S. 9: in: D. Kleiner (1987)
(4) W. Heckmann, zit. nach G. Grimm (1985), S. 50
(5) ebd, S. 51
(6) G. Grimm (1985), S. 90
(7) Die Fassung des Betäubungsmittelgesetzes vom 1.1.82
(8) Zit. nach G. Grimm (1985), S. 22
(9) W. Heckmann: Therapeutische Gemeinschaften für Drogenabhängige. Geschichte-Gegenwärtige Praxis – Zukunftsprobleme, in: ders. (1980), S. 10f
(10) W. Burian/I. Eisenbach-Stangl (1980), S. 13
(11) Zit. nach Kury, H. /Dittmar, W. /Rink, M.: Zur Resozialisierung Drogenabhängiger — Diskussion bisheriger Behandlungsansätze. In:Wiener Zeitschrift für Suchtforschung, 1980, S. 135ff (1980), S. 142
(12) H. Brömer: Pioniere ohne Auftrag, in: W. Heckmann (1980), S. 76
(13) F. Bschor (1983), S. 749 f
(14) «Die Tageszeitung», 02.10.92