Dorfstrasse und eine Hochzeit
Ein Nachtrag zu Cabanaconde, damals noch ein winziges Bauerndorf, eine Tagesreise nördlich von Arequipa, in den peruanischen Anden (1984). Mehr Fotos im April 2011: „Valle de Colca“.
Aus meinem Reisetagebuch, 24. März 1894, Juliaca:
Mit der Fahrt nach Cabanaconde fing die Reise erst richtig an, obwohl wir schon rund einen Monat unterwegs sind, nicht vom Gefühl her, sondern von der Intensität der Eindrücke. Wenn es nicht regnen würde, wäre alles vielleicht schöner und angenehmer, aber die Stimmung ist irgendwie authentischer.
Unser Hotelzimmer [in Juliaca], in einem ehemals großzügigen und vornehmen Hotel am Hauptplatz, jetzt total abgewrackt und baufällig. Die Wasserleitungen laufen außen an den Fluren entlang, die Waschbecken sind undicht, eine Glühbirne an der Decke beleuchtet unsere Wäscheleine und die Strümpfe daran, ein Schrank, dessen eine Tür abgebrochen ist und außen vorlehnt, die beiden Fensterflügel zur Plaza sind mit Latten von innen vernagelt – wohl weil der Balkon nicht sicher ist, feuchte Fußbodenbretter, überall ist der Putz heruntergefallen, und wir meditieren darüber, wie man mit den einfachsten Mitteln oder sogar nur mit gutem Willen vieles reparieren könnte.
Von Arequipa aus geht die Fahrt erst Richtung Küste durch endlose Steinwüsten. Wieder rollen von links die grauen Wanderdünen Richtung Straße, die ihr vorläufiges Ende bedeutet. Irgendwann biegt die Route nach Norden ab. Einige Bewässerungskanäle sorgen für ein bisschen Vegetation. Was könnten die Leute alles mit der Nutzung von Sonnenenergie anfangen!
Die Schotterstraße führt durch Sandwüste, wir bleiben einmal im Sand stecken. Ein irrer Gegensatz: Wenig später schraubt sich die Straße in endlosen Serpentinen bis in eine so hohe Zone hinauf, dass der Nebel alles bedeckt.
Wir passieren Huambo [3332 m], wo zum ersten Mal ein „Andendorf“ auftaucht. Die Leute starren uns an, schrecklich ärmlich, die Frauen in Tracht, aber der Eindruck ist noch wie im Zoo – so ein Widerspruch zu Arequipa.
Spät in der Nacht kommen wir nach einer haarsträubenden Fahrt an Abgründen entlang in strömendem Regen an. Der Nebel ist so dicht, dass man die andere Seite der Plaza [von Cabanaconde] nicht erkennen kann. Taschenlampen irren durch die Gegend. Das Wasser rauscht in Bächen überall entlang.
Es gibt nur ein alojamiento, mit Schlafsaal, das als die Unterkunft mit dem fürchterlichsten Klo in die Reiseannalen eingehen wird. In einem höhlenartigen „Restaurant“ gibt es noch ein cena, und wir kommen nicht darum herum, noch eine drittes „Abendessen“ für den Hotelchico [Der Junge, der in der Nacht der „Manager“ war] auszugeben. Der chico ist total nervig, folgt uns auf Schritt und Tritt und will mehr Geld. Wir trinken im Dunkeln auf der Plaza noch einen Kakao im Stehen und quatschen mit den Frauen dort.
Zum Klo muss man zehn Meter durch einen total verschlammten Hof. Das baño besteht aus eine windschiefen Hütte, überall steht Gerümpel herum, der Fußboden ein Matsch, das Klo nur ein runder Hohlstein mit einem hölzernen Deckel, natürlich total vollgeschissen. Keiner von uns beiden schafft es in den drei Tagen, sich richtig zu erleichtern. Das „Hotel“ besteht aus mehreren Lehmziegelhütten, teilweise mit Wellblech oder Stroh gedeckt, wie die meisten Häuser des Ortes. Die Leute kochen im Hof, mitten im Müll, in einem rußigen Top, daneben liegt ein blutiges Schaffell. Im ganzen Ort gibt es kein elektrisches Licht.
Trotz der Unannehmlichkeiten merkt man, dass Cabanaconde für viele Dörfer in der Sierra repräsentativ ist, für die traurigen, resignative Stimmung. Nur einige Frauen verändern das Bild zum Positiven. Die meisten tragen Tracht: Sandalen, lange Röcke, einige dunkelblau mit bestickten Säumen, ein Hemd, darüber eine reich verzierte Weste, ein Wickeltuch um die Hüfte, was seitwärts herunterhängt, und eine Decke zum Umhängen, zwei oder mehr Zöpfe und einen bestickten Hut.
Einige Frauen sehen recht selbstbewusst aus, und fotografieren geht leider nicht. Die Männer sind kaum zu sehen, aber einige Betrunkene bevölkern tagsüber die Plaza. Ab und zu treiben Bauern ihre Schafe und Ziegen durch den Ort. Ihre Kleidung besteht oft nur aus Fetzen.
Frühstück: Eine Tasse Kaffee und ein Brötchen. Am ersten Morgen wachen wir auf und sehen einen riesigen schneebedeckten Sechstausender [den Hualca Hualca] – ein atemberaubender Anblick. Die Dorfstraßen sind so eng, dass bis auf eine [vgl. Foto ganz oben] kein Auto durchkäme, in der Mitte ein Ablauf, ansonsten mit dicken Steinen teilweise „gepflastert“. Von oberhalb des Ortes kann man sehen, dass in einigen Teilen viele Häuser verlassen sind.
Am Nachmittag geraten wir in eine Hochzeit: Man winkt uns hinein. Ungefähr ein Dutzend Leute in Tracht, behängt mit Früchten, vor allem Zwiebeln, und geschmückten Hüten und eine stark angetrunkene Kapelle, die entsprechende Weisen vorträgt. Wir werden zu Schnaps genötigt. Die Braut, auch schon sehr angeheitert, will sich halb im Ernst mit mir verloben, aber die Vortänzerin [hinten rechts auf dem Foto] hat alles im Griff.
Der Bräutigam bringt kaum ein Wort heraus. Einer der Männer fällt in den Schlamm und steht nicht mehr auf. Eine uralte Frau mit weißen Haaren, sehr würdevoll, begrüßt uns sitzend auf Quechua. Sie spricht kein Spanisch.
Endlich bewegt sich die ganze Gesellschaft durch das Dorf zum Haus des Bräutigams, wo wir zu Suppe – mit einigen Kohlblättern – sowie Schnaps und Chicha aufgefordert werden. Wir unterhalten uns vor allem mit einem älteren Izquierdista, der alle Alemanes über den grünen Klee lobt und auf die Amis schimpft.
Männer und Frauen sitzen getrennt. Auf einem Teller liegt Geld, und jeder Betrag [der spendenden Gäste] wird mit Namensnennung auf einem Zettel vermerkt, speziell unsere deutsche Mark wird gesondert diskutiert. [Anmerkung: Ich war in einem Dilemma – die Maximalspende der Gäste war umgerechnet eine Mark wert; hätte ich weniger gegeben, hätten sie von mir gedacht, dass ich als reicher Gringo ein Geizhals wäre. Hätte ich aber wesentlich mehr gegeben, hätte das den Leuten ihre Armut demonstriert und wäre auch beleidigend gewesen. Ich hab dem Brautpaar also eine Mark und erklärte ihnen, wieviel diese umgerechnet in peranischen Soles wert war. Manche der Gäste konnten nur ein paar Zwiebeln oder einen Kohlkopf schenken.
Was nicht in meinem Tagebuch steht, was ich aber nie vergessen werde: Die größte Sensation war, als ein sehr alter Mann den Raum betrat und, da kein Platz frei war, ich aufstand und ihm sagte, ich sei jung und er solle sich bitte auf meinen Platz setzen. So etwas erwarteten sie offenbar übehaupt nicht. Der Mann tat es und murmelte ständig vor sich hin, was ich für ein „komischer“ Gringo sei – für einen Bauern aufzustehen. Die Männer wollten umgehend eine Kommission zusammenstellen, die uns in die grandiose Schlucht [Colca-Canyon – der dritttiefste Caynon der Welt] führen sollte, damit noch mehr Touristen kämen. Wir waren wohl die ersten. Zum Glück waren alle so betrunken, dass es sie diesen Plan wieder vergaßen – sie wären wohl alle in die Schlucht gestürzt. Der Mirador de Achachihua, den man heute dort sehen kann, könnte ein Resultat dieses Plans sein, den irgendwann irgendjemand umgesetzt hat.]
Wir schaffen uns kaum, uns zu verabschieden: Der Bräutigam, nur noch flüsternd, ist so gerührt, dass er in Tränen ausbricht und uns ständig umarmt. Um sechs Uhr verlassen wir die Feierlichkeiten, nur um festzustellen, dass die Señora unserer Unterkunft doch nichts gekocht hat. Unregelmäßig wird abends auf der Plaza Essen verkauft, fast nur Kohlenhydrate. Wir haben Glück.
Ab drei Uhr Nachmittags regnet es jeden Tag, und später wird der Nebel undurchdringlich dicht. Wir gehen zwischen sieben und acht ins „Bett“, weil man ohnehin nichts unternehmen kann.
Tecsecocha
Bei diesem Foto brauche ich Hilfe derjenigen, die sich in Cusco, Peru auskennen. Ich war dort im Januar 1980 und im Juli 1984, beide Male im Hostal Bolivar, Tecsecocha 2 – das wurde im legendären South American Handbuch erwähnt. Wenn ich mich recht erinnere, zeigt das Foto genau der Eingang des Hostals, jedoch sieht das Bild der heutigen Ansicht kaum ähnlich. Google nennt die Straße Teqsiqocha.
Das Hostal war fußläufig vom Plaza de Armas, und dort in der Nähe gibt es laut Stadtplan sonst keine dieser Ecken. Seitenverkehrt, was ich auch probiert habe, macht es gar keinen Sinn.
Es kann natürlich sein, dass das Haus, was beide Male extrem preiswert und ein Geheimtipp für Gringos war, und der Eingang total umgebaut worden sind, da das heutige Cusco mit dem von damals nicht mehr viel zu tun hat. Damals gab es nur eine (!) Kneipe, in der sich die wenigen Rucksack-Touristen trafen, eine winzige „Pizzeria“ in der Procuradores.
Arequipa oder: are quepay!
Arequipa (Peru), die „weiße Stadt“, das Zentrum des Südens – die Altstadt ist Weltkulturerbe.
Wenn man das obere Foto genau betrachtet und es mit der Perspektive von heute vergleicht, erkennt man, dass der Riss im Bogen, der vermutlich von einem der zahlreichen Erdbeben in der Region stammt, ausgebessert zu sein scheint. Damals habe ich mich kaum getraut, darunter herzulaufen. Von wo aus ich damals den Plaza Mayor fotografiert habe, konnte ich nicht genau ermitteln; ich muss wohl irgendwo im 1. Stock der Bogengänge gestanden haben.
Aus meinem Reisetagebuch, auch über das Monasterio de Santa Catalina, März 1984:
In Arequipa waren wir sieben Nächte, vor allem wegen B.s Durchfall, der jetzt [21.3.] endgültig vorbei ist. In Arequipa fällt mir zuerst das Frauenkloster ein. Der Konvent war auch das einzige, was wir außer einem kurzen Blick in die Kathedrale, wirklich besichtigt haben. Das Kloster ist wie eine Miniaturstadt mit offenbar streng geregelten Möglichkeiten, mit der Außenwelt Kontakt aufzunehmen. Doppelt holzvergitterte Fenster sind die einzige Sprechmöglichkeit mit Besuchern. Der Gang innen nach oben ist mit durchsichtigen Steinen versehen, da dass Tageslicht hereinkommen kann.
Die ganze „Stadt“ mit kleinen Straßen und Plätzen gliedert sich in zwei Abteilungen, die für die jungen Nonnen, in der das meiste gemeinsam gehalten ist (Schlafsaal, Küche) und eine für die sozialen Aufsteigerinnen mit eigenem Zimmer und einem für Bedienstete. [Im Kloster lebten rund 400 Nonnen. Es wurde erst 1970 zum ersten Mal der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.]
Originell sind die riesigen, auf die Hälfte verkleinerten Weinkrüge (?! zum Waschen. Außerdem gibt es in einem Café des Klosters leckeren Kuchen, untermalt mit den Brandenburgischen Konzerten – das ist natürlich eine Konzession an die Touristen.
Wenn man sich vorstellt, dass das Kloster die einzige Gelegenheit für Frauen war, aus der Gesellschaft „auszubrechen“, hat es eine ähnliche Funktion wie ein heutiges Frauenhaus. [Dem Vergleich würde ich heute nicht mehr ziehen.] Dafür spricht auch die Marienverehrung, demgegenüber Jesus ziemlich schlecht abschneidet.
Das Hotel Tradition, in dem wir waren [Calle Sucre, das scheint nicht mehr zu existieren, vgl. Foto unten der Hof, oben meine damalige Freundin], war aber auch nötig. Heißes Wasser und ein sauberes Klo! Wenn wir gewusst hätten, was uns danach erwartete [ich hatte das in Chivay im Valle de Colca geschrieben, ca. eine Woche nach dem Aufenthalt in Arequipa], hätten wir das noch mehr zu schätzen gewusst.
Fast jeden Tag gehen wir in den einzigen Gringo- und Bonzentreff, den „Grill“ einer alten Schweizerin [am Hauptplatz], die ziemlich rassistisch denkt. Die „kleinen Dunklen“, die alles „nebeneinander“ machten, mag sie gar nicht. Es gibt Apfelstrudel, silbernes Besteck und Porzellangeschirr, aber dafür reißt sie einem auch alles wieder aus der Hand, kaum dass man fertig ist. Das Lokal besteht fast nur aus Einrichtungsgegenständen, die wohl noch aus den 40-er Jahren stammen: Ein Plakat der V. Olympischen Winterspiele, ein von einer kleinen antiken Wandleuchte bestrahlter Alphornbläser und natürlich der Schweizer Fahne. Ambulantes und Bettler werden nicht hineingelassen.
Das Wichtigste in Arequipa war der Markt mit einer der größten Markthallen, die ich je gesehen habe. Wir probieren jeden Tag jugos, unter anderem von manzanas, der aber natürlich wie süßes flüssiges Apfelmus schmeckt. Außerdem trinken wir literweise Coca-Tee, der aber so ähnlich wie jeder andere Tee wirkt und schmeckt.
In Arequipa fallen mir die vielen Bettler auf, viel mehr als in Lima. Der Übergang zum fliegenden Händler ist fließend. So etwa wie die Losverkäufer, die im Rollstuhl sitzen oder mit epileptischen Zuckungen noch etwas verkaufen wollen.
Das bemerkenswerteste Erlebnis, bei dem ich noch mächtig stolz auf mich war, war der geglückte und doch nicht geglückte Taschendiebstahl. Im totalen Gedränge wurde B. von zwei Kerlen zusammengequetscht und bemerkte plötzlich, dass ihr Portemonnaie in der Beintasche [der Cargo-Hose] fehlte. Zum Glück war es nur unser „Diebesgeld“* und nur ein paar Dollar darin. Wir merkten aber, wer es gewesen war, weil der Typ abflitze – und ab in die Markthalle.
Ich rannte hinterher. Am Eingang riefen schon die Marktfrauen arriba! [Er ist oben!] Ich nahm die Empore von der anderen Seite, sah auch den Kerl, der, als er mich erblickte, die Treppe wieder hinunterstürzte. Ich hinterher, quer durch das Gemüse, bis ich ihn schnappte. Zufällig stand ein Polizist daneben, der aber nur mit seiner Pfeife trillerte, mir aber ansonsten das Feld überließ und nichts tat.
Nachdem ich auf’s Geratewohl behauptet hatte, in dem Portemonnaie seien 5.000 Soles gewesen [damals weniger als ein Dollar] und eine drohende Haltung einnahm, rückte der Kerl 5.000 Soles heraus – das waren aber nicht die unseren. [Der andere Dieb hatte Geld und Portemonnaie; dieser hatte mich nur ablenken wollen, indem er wegrannte.] So retteten wir immerhin plus minus Null, obwohl ich gern das Gesicht des Typen gesehen hätte, wenn der später versuchte, die Lira in einer Bank einzuwechseln. Das Portemonnaie haben sie vielleicht auch zu verkaufen versucht.
Auffallend am Markt ist der starke „indianische“ Einschlag, mehr auf den Straßen rund um den Markt. Jede „Berufsgruppe“ hockt zusammen, Fleisch, Fisch, Gemüse, Obst, Coca, Kräuter, Nähmaschinen, die wie in einer frühkapitalistischen Manufaktur gemeinsam rattern, Eisen, Krimskram, Plastik, bäuerlicher Bedarf, Schuhe.
In Arequipa ist sonst nicht viel los [1984!]. Wir gehen um neun ins Bett. Morgens können wir den Misti sehen und noch eine schneebedeckte Bergkette. Bei schönem Wetter – es soll nur fünf Regentage im Jahr geben, die wir fast alle erwischt haben – muss die Aussicht toll sein.
In den Zeitungen steht viel über den Generalstreik am 23. März. Vom Hotel aus sehen wir sogar keine kleine Männer-Demo, die, die Reihen fest geschlossen, zum paro nacional aufruft. Der soll aber laut Auskunft des Touristenbüros nur 24 Stunden dauern. (…)
Am Sonntag – der Hotelseñor leiht uns noch seinen Wecker – marschieren wir zur Jacantaya-Busgesellschaft am Busbahnhof und fahren nach Cabanaconde.
_____________________________
*Ich hatte bei jeder Reise ein kleines Portemonnaie mit ein paar Dollar und großen, aber wertlosen italienischen Lira-Scheinen dabei. Falls ich überfallen worden wäre, hätte ich das herausgerückt. Alles andere Geld war im Geldgürtel – so etwa kannte kaum jemand in Südamerika – oder woanders versteckt.
Lima, Ancash y Carabaya
Und siehe, ich kramte in den Tiefen meines digitalen Archivs und fand ein Bild, das sich ein paar Jahre vor mir versteckt hatte, fotografiert 1984.
Ich habe einige Zeit nach dem richtigen Blickwinkel gesucht: Es ist die Jíron Ancash, Ecke Jíron Carabaya.
Da ich während der damaligen Reise zwei Mal in der peruanischen Hauptstadt war, kann ich nicht mehr sagen, in welchem Monat das war – ich vermute aber der Februar.
Im Hintergrund kann man die Basílica y Convento de San Francisco de Lima erkennen. Deren Katakomben hatte ich 1979 fotografiert.
Salcantay – der wilde Berg
Der Salcantay (6.264 Meter) in den Anden Perus. Fotografiert im Juli 1984. Ich dachte zunächst, das sei derselbe Berg wie auf dem Foto bei Ayapata – also der Huayanay. Wenn man aber mein Foto mit anderen vergleicht, sieht man den Unterschied.
Ich war zwei Mal da, zum ersten Mal im Januar 1980 – damals aber zur Regenzeit. Im Januar schüttet es jeden Tag ein paar Stunden am Nachmittag. Dafür ist es in der Sommerzeit in der Nacht schweinekalt.
Wenn ich mir einige des Fotos noch einmal anschaue, komme ich aus dem Staunen über die einfach großartige Bergwelt Perus nicht heraus. Die Anden sind außerdem – bis auf die Pfade zu den Inka-Ruinen – selbst heute bei weitem nicht so überlaufen wie die Alpen.
Vor und hinter Lupinen
Unsere Herberge (very, very basic) auf Amantani, einer Insel im Titacacasee auf der peruanischen Seite. (Die Frau ist meine damalige Freundin.) Ich kann das Haus nicht mehr finden, es war nördlich von der Dorfkirche. Ich kann auch auf Google Maps kein Lupinenfeld erkennen.
Der „Herbergsvater“ hat uns noch bis zum Centro Ceremonial Pachatata auf dem höchsten Berg geführt (der Berg im Hintergrund). Er erzählte, dass sein Vater die Ruinen bzw. die Häuser des Heiligtums noch habe intakt gesehen, aber da das Land knapp sei, brauchten die Leute die Steine. Die ersten Touristen seien erst vor zwei oder drei Jahren auf der Insel gewesen.
Ich muss überlegen, welche Früchte das sind? Weiß das jemand auswendig?
Puno (Update)
Puno am Titicacasee, Peru, fotografiert Ende März 1984.
Update: Ich hatte das Foto verkehrt herum eingescannt und wurde durch einen aufmerksamen Leser korrigiert. Ich habe damals auf dem Mirador Manco Capac gestanden.
Ich hätte geschworen, dass ich dieses Foto schon publiziert hatte. Vor ein paar Tagen sprach ich mit einem Peruaner, der aus Puno stammte, und wollte ihm das Foto zeigen, weil er zu der Zeit noch gar nicht geboren war – und fand es nicht auf meiner Website. Ich war 1980 schon einmal in Puno und bin mir nicht absolut sicher, aus welchem Jahr das Foto stammt – wahrscheinlich aber doch von 1984.
Ich habe versucht, die Perspektive per Google Street View wiederzufinden und bin eine Weile durch mehrere Straßen „gefahren“. Es könnte auf der Circunvalacion gewesen sein oder auf der Choquehuanca in der Nähe des Mirador El Condor, vermutlich ist der damalige Blick auch verbaut worden.
Aus meinem Reisetagebuch – März 1984 (ist alles belanglos, aber für mich sind das interessante Erinnerungen – und meine Ex von damals liest hier auch manchmal mit):
Wir fahren mit einem Bus [von Juliaca] nach längerem hin- und herfragen nach Puno, was von oben ganz anders aussieht als ich es in Erinnerung hatte. Die Berghänge sind jetzt hoch bebaut. Wir latschen herum, bis wir im Hotel Extra in einem Vierbettzimmer unterkommen. [Moquegua 124, scheint es nicht mehr zu geben].
B. geht es magenmäßig schlecht und wir entschließen uns, den Markt im Zentrum – außer für jugos – nicht mehr zu betreten. Dafür essen wir gut und viel Fisch und zwei Mal in einer Gringo-mäßigen vegetarischen Kneipe. Ich kaufe mir nach ewig langem Gefeilsche noch eine Decke.
In Puno gibt es zwei Plaza de Armas [kann ich heute nicht mehr bestätigen], der eine mit einer rosa-orangenen Kirche, die wir sofort „Bonbonkirche“ taufen. Es laufen ausgesprochen viele Gringos herum, aber wir kommen mit niemandem in Kontakt, vielleicht weil wir schon um neun im Bett sind und die Musikkneipen erst um die Zeit anfangen. (…)
Wir müssen uns offenbar noch längere Zeit beim caminaren zurückhalten, denn wir pusten schrecklich nach längeren Wanderungen. [Puno liegt 3.800 Meter hoch.] Vielleicht hat die Verdauung auch etwas mit dem Kreislauf zu tun; wir fühlen uns beide gesundheitlich nicht ganz auf der Höhe.
Wir verabreden am Kai, dass wir nach Amantani fahren [per Boot] und decken uns mit Obst und Schnaps ein. (…) Am Morgen kommt B. auf die Idee, mit dem Fahrradtaxi, von denen es schon hunderte in Juliaca gegeben hat, zu fahren. So kommen wir bequem am Kai an.
Ayapata
Noch einmal der Camino de los Incas, auch bekannt als „Inca trail“, der Anstieg zum Pass Warmi Wañusqa, knapp über 4.000 Meter. Die Frau ist meine damalige Freundin. Im Hintergrund der Huayanay (5,464 Meter). Fotografiert im Juli 1984.
Schon lustig, dass heute da Zeltplätze sind (campamento). Damals gab es nichts, man musste in freier Wildnis oder in den seltenen Ruinen zelten und selbst sehen, wo man Wasser herbekam.
(Vgl. 08.01.2020: „Warmi Wañusqa oder: Die Frau, die starb“ sowie 04.01.2012: „El camino de los Incas“.)
Nicht an der blauen Donau
Puerto Maldonado, Peru, früher auch bekannt als Faustinos Ort, am Rio Madre de Dios, fotografiert Ende Juni 1984.
Zu sehen ist der Plaza de Armas, an den ich mich besonders erinnere, weil ich zum ersten Mal einen Platz sah, der von großen Gummibäumen gesäumt wurde. Ich kannte den Ficus elastica bis dahin nur als Zimmerpflanze. Der Platz wurde 2019 umgestaltet.
Ich hatte große Probleme, den Punkt wiederzufinden, von wo aus ich damals fotografiert habe. Das Türmchen in der Mitte des Platzes sieht von jeder der vier Straßenkreuzungen aus gleich aus; ein Hinweis bot mir der Wasserturm, der hinten rechts ein wenig zu erkennen ist und den ich vom Fluss aus schon vorher geknipst hatte, weil er mir nach der wochenlangen strapaziösen Dschungel-Tour durch den Pando wie ein Leuchtfeuer für die Zivilisation vorkam. Ich tippe also auf die Avenida Leon Verlarde Ecke Daniel A. Carrion. Das damalige Restaurant Danubia Azul („Zur blauen Donau“ – sehr passend) war da, wo man jetzt den Neubau sieht.
Die große Brücke, die Puerto Maldonado mit dem östlichen Ufer des Rio Madre de Dios verbindet und heute die längste Brücke Perus, gab es damals noch nicht. Wenn man per Google Maps Street View „darüberfährt“, findet man den Wasserspeicher. Ich vermute, es ist noch derselbe, nur frisch gestrichen. Wenn nicht, müsste ich umdenken.
Wenn ich heute darüber nachdenke und das halb vergilbte Reisetagebuch versuche zu entziffern, merke ich erst, welche großes Abenteuer das damals war. Wir planten auch, uns unter die Goldwäscher zu mischen. Aber das scheiterte daran, dass meine damalige Freundin gesundheitliche Probleme hatte und auch so von Moskitos zerstochen wurde (was noch schlimmer geworden wäre), dass sie keine Lust dazu hatte. (Ich werde aus unbekannten Gründen sehr viel weniger von den Biestern malträtiert als andere.)
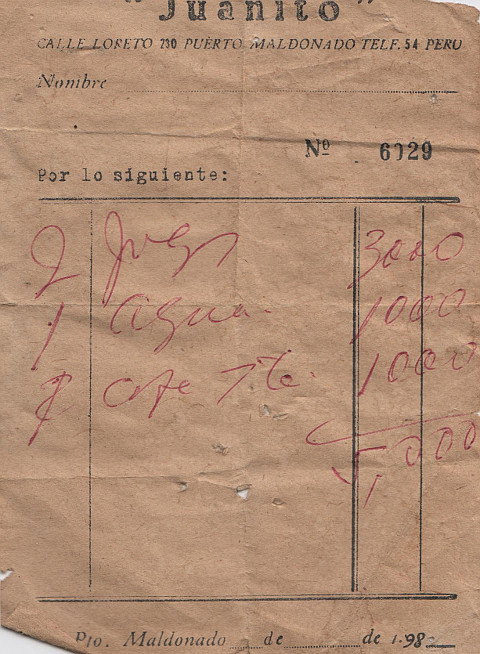
Hermanas
Bauernmädchen auf der Insel Amantani, Titicacasee, Peru.
Vgl. Amantani 29.08.2013, Amantani revisited (05.03.2019, Insel der Sterne (11.12.2019), Colorido 02.11.2019), K’Uyuy (30.07.2018), Vorsicht Kamera! (04.03.2019), Grumpy Girl (22.11.2013).
Cusco, revisitado
Cusco, Peru, am Mercado Central de San Pedro, auf den Treppen vor dem Bahnhof fotografiert, Juli 1984.
Platz der Waffen
Plaza Mayor also known as Plaza de Armas (kein deutscher Wikipedia-Eintrag, vermutlich wegen gefühlter Irrelevanz), Lima, Peru, fotografiert im Juli 1984. Bei dem obersten Foto bin ich mir nicht ganz sicher, ob das wirklich auf dem Plaza de Armas war…
Islas Ballestas
Bootsausflug zu den Islas Ballestas vor der Küste Perus (bei Pisco), März 1984.
Aus meinem Reisetagebuch:
In Pisco ging uns das Hotel Mi Casa auf die Nerven, obwohl es extrem billig war: Total verdreckte Klos ohne Wasser und Licht, ebenso das winzige Zimmer. Der einzige Pluspunkt war das Fenster zur Straße. Außerdem hatte wir beide – mit einem Tag Unterschied – Darm- und Magenverstimmung und fühlten uns sauelend.
Das herausragende Erlebnis war der Ausflug zu den Inseln. Die Leute sind manchmal richtig lieb und niedlich, so der Opa, der die Karten dazu verkauft. Klein, weisshaarig, murmelt bei unseren Namen etwas von como los rusos und freut sich.
Die Inseln: Klippen mit Felsentoren, schäumende Brandung, Pelikane, Pinguine, Möwen, kleine Enten, Seelöwen. Die peruanischen Touristen haben natürlich nichts besseres zu tun als die Tierchen mit Händeklatschen und Pfiffen zu belästigen.
Länger hätte ich in Pisco nicht bleiben können. Das Baden ist schlecht, die Strände in Pisco Puerto sind verdreckt, und das Wasser ist flach und kalt. Auffallend war ein riesiges Holzkreuz mit Totenkopf und anderen angenagelten Gerätschaften.
Viele Leute aus der Sierra scheinen an die Küste zu ziehen, vielleicht wegen des Wetters oder auch, weil es den Menschen hier besser zu gehen scheint. Den Zeitungen ist zu entnehmen, dass die Förderung der Wirtschaft nach dem Parteien-Prinzip zu funktionieren scheint, und zwar ziemlich krass. Die Gebiete, die zum Beispiel unter „linker“ Verwaltung stehen, kriegen gar nichts.
Interoceanica, revisited
Das Foto habe ich 1984 gemacht, von der Ladefläche eines LKW aus (vermutlich ungefähr hier) – auf einer der damals gefährlichsten Straßen (Teil der Interoceanica Sur) der Welt. (Was man auf dem Foto sieht, ist die „Straße“. Vgl. auch On the Road, 22.11.2018)
Aus meinem Reisetagebuch, Ende Juli 1984:
In Puerto Maldonado verpassen wir den Volvo [LKW], der früh am Morgen mit Holz losfährt, weil wir fälschlicherweise annehmen, dass er nicht pünktlich sei. Wir müssen mit einer Moped-Taxe zum Kontrollpunkt, wo sogar ein kleines Wartehäuschen mit Dach steht. In der Kneipe nebenan gibt es ein originelles Spiel: ein Frosch, umgeben von kleinen Felltütchen, in die man Münzen werfen muss – derjenige gewinnt, der genau in das Maul des Frosches trifft.
Am Nachmittag kommt ein LKW, der uns mitnimmt, allerdings laden wir bis spät in die Nacht hinein Holz auf, das die Siedler am Wegesrand verkaufen. Später erfahren wir, dass eigentlich geschnittenes Holz nicht in die Anden transportiert werden darf, aber der Polizist, der kontrolliert, möchte dann ein regalo von zwei „Hölzchen“.
Ungefähr bei Kilometer 140 kann man für kurze Zeit in der Ferne schneebedeckte Berge sehen [die Cordillera Vilcanota]. Dann kommen die ersten Hügel, ein Blick von oben auf das grüne Meer der Ebene, und es geht wieder in unendlichen Kurven aufwärts.
Die Vegetation wird vielseitiger, alles ist „well-stocked“ mit bunten Blüten und Orchideen. In Marcapata machen wir Rast essen in Caranavi-ähnlicher [d.h. großartiger] Stimmung.
Die ersten beiden Nächte sind einigermaßen erträglich, obwohl jeder von uns nur ein ca. 30 cm breites Brett als Untergrund zur Verfügung [auf der Ladefläche des LKW] hat.
In der dritten Nacht überqueren wir die Cordillera und frieren uns trotz Pullover, Hosen und Mütze einen ab. Im Morgengrauen halten wir in einem winzigen Dorf vor Ocongate…
Nazca, backstage
Nein, die weltberühmten Nazca-Linien habe ich mir nicht angesehen, ich bin 1984 nur, wie man hier sieht, vorbeigefahren (auf dem Weg von Ica nach Camana) – der Beobachtungsturm wäre mir auch zu klein gewesen. Jemand war offenbar mit dem Moped da.
Aus meinem Reisetagebuch, März 1984, auf der Panamericana durch die Wüste nach Süden:
Es ist erstaunlich, welche Assoziationen man bekommt, wenn man bis zum Horizont buchstäblich bis zu einer flachen Sandfläche nichts sieht. Oder: Totale Steinwüste, Wanderdünen, deformierte und erodierte Felsengebirge und an den unmöglichsten Stellen plötzlich Dörfer oder Häuser.
Die Flüsse aus den Anden verbreitern sich, und die Leute bewässern jedes Stückchen Erde in den Tälern, bauen das Dorf aber woanders hin. Einige Täler sind noch völlig mit Resten von Terrassen bedeckt, die teilweise nur an aus der Ferne als Streifen auf dem Boden zu sehen sind.
Auf die Frage an unseren Autobesitzer, warum denn die Leute keine Terrassen bauten? sagt er nur, es sei kein Wasser dafür da. Lächerlich.
In der Nacht hat ein Fluss die Straße überschwemmt. [Vermutlich war es bei Capisca.] Es sieht unheimlich aus, aber als ein Ormeño durchkommt, wage ich es auch [mit dem Volkswagen], und den lauernden Dorfbewohner entgeht ein Trinkgeld.
Spät in der Nacht erreichen wir Camana…
Bergwelt
Fotografiert 1984 in den peruanischen Anden, irgendwo auf dem Camino de los Incas, auch bekannt als Inca-Trail.
Warmi Wañusqa oder: Die Frau, die starb

Warmi Wañusqa, 4200 Höhenmeter, „…a mountain pass in the Cusco Region in Peru. It is located in the Urubamba Province, Machupicchu District.“
Aus meinem Reisetagebuch, Juli 1984, auf dem Camino de los Incas, Peru, auch bekannt als Inca-Trail:
… Es geht unablässig steil aufwärts, mit kurzen, nur meterlangen Passagen zum Ausruhen. Der Berg hinter uns gilt als Maßstab; wir steigen wirklich sehr schnell. Bald sind die drei weißen Steine [Wayllabamba] des ersten Zeltplatzes zu sehen, aber B. kann das letzte Stück einfach nicht mehr. Ich gefalle mir darin, ein wenig mit zwei Rucksäcken zu laufen. Wir erreichen mit letzter Kraft den Platz. Uns folgt der verrückte Kalifornier, der vor vier Wochen einige Sechstausender bestiegen hat und der zudem Marathonläufer ist.
Wir descansaren und sehen nach und nach noch einige total fertige Gringos eintrudeln; andere – nur wenige – steigen scheinbar ohne Ermüdungserscheinungen weiter.
Bald klettern wir weiter und hängen trotz des erzwungenen Beinahe-Gänsemarsches einige noch ab – sie hätten sich vielleicht ausruhen sollen. Jetzt geht es durch einen Märchenwald steil, sehr steil aufwärts, knapp zwei Stunden, und dann taucht kurz vor Erreichen der Baumgrenze ein wunderschöner kleiner Platz auf, eine Wiese mit Büschen und Bäumen. Wir zelten oberhalb, wo schon zwei andere Zelte stehen, weil es näher zum Wasser ist. Letzteres ist eher flüssiges Eis statt Wasser.
Wir müssen uns mit allen warmen Sachen anziehen, kochen unser Essen und genießen den prächtigen Blick auf der Berge ringsum, deren Hänge und Schneefelder sich in der Dämmerung langsam rosa färben. Gleichzeitig wird es kalt und kälter. Unter großen Mühen entfachen wir noch ein Feuer, das alle zitternden Umstehenden für eine kurze Zeit wärmt, dann zieht es alle ins Zelt.
Am nächsten Morgen stehe ich als erster draußen; das Zelt ist mit einer Eisschicht überzogen, B.s T-Shirt liegt gefroren auf einem Busch und die Wiese ist total glitschig. Der Ofen macht Schwierigkeiten, wir sind über 4000 Meter hoch, aber irgendwann bequemt er sich, und der warme Kaffee weckt allmählich die Lebengeister, selbst die kalten Zehen erwärmen sich. So beginnt der dritte Tag….
Frohe Festtage!
Cabanaconde, damals noch ein winziges Bauerndorf, eine Tagesreise nördlich von Arequipa, in den peruanischen Anden (1984). Der Bräutigam (links, neben ihm seine Braut) hieß Huaman Huamani, sein Name soll hier als Dank für die Einladung und das unvergessliche Erlebnis verewigt werden. [Reprint vom 11.01.2011]
Insel der Sterne
Die Iglesia de San Antonio Abad auf der peruanischen Insel Amantani, fotografiert im April 1984 (Ich habe nur zwei Fotos dieser Kirche gefunden). Damals gab es weder gepflasterte Straßen auf der Insel noch irgendeine Herberge. Wir waren bei Bauern privat untergebracht. Aus meinem Reisetagebuch:
Der Aufenthalt in Amantaní ist das interessante Gegenstück zu Cabanaconde. Der vierstündige Bootstrip [von Punu aus] zeigt Plätze, an denen die Schilfboote gebaut werden. In Amantaní werden wir von der Familie schüchtern empfangen und bekommen ein sauberes und hübsches Zimmer mit zwei Betten inklusive einer Matratze aus Schilf und einem Steintisch. (…)
Zu allen Mahlzeiten gibt es den obligatorischen Mate de Muña, ein Kraut, das den Magen beruhigen soll, bei mir aber nach drei Tagen das Gegenteil bewirkt. Zum Frühstück Brot und Ei. Mittagessen und cena: Suppe (sieht gut aus und schmeckt gut), secundo: Ei mit papas fritas und Reis, am Sonntag Fisch (Pejerrey).
Vermutlich hat mein Magen das Fett der papas fritas nicht vertragen, denn ich kriege Durchfall. Das baño ist ein ordentlich mit Steinen eingefasstes Loch hinter dem Haus, das bald von unserem Klopapier vollgestopft ist. Nachts ist das ärgerlich, aber der señor [Hausherr] stellt mir schließlich einen ehemalige Topf als Pinkelpott ins Zimmer.
Die Frauen sprechen nur Quechua und tragen als Inseltracht einen schwarzen Schleier, den sie, wenn sie die Insel verlassen, gegen den obligatorischen Hut eintauschen. Wir sehen die Mädchen weben, die beiden Jungen bauen kleine Boote aus Schilf, wie ich es nicht hätte tun können. Die ultima (das jüngste Kind der Familie, das keinen Namen hat) trägt einen riesigen Hut mit breiter Krempe wie alle ultimas.
Auf dem Pachatata ist eine kleine Ruinenstadt mit einem viereckigen ummauerten Platz, wo sich am 22. Januar alle Leute der Insel treffen, um zu feiern. Der señor, der uns führt, erzählt, noch sein Vater habe die Häuser der heutigen Ruinen intakt gesehen, aber da das Land knapp ist, brauchten die Leute die Steine. Er sagt, auf Taquile [was damals bei Touristen „angesagt“ war] gebe es nichts Interessantes, und die Leute zögen ihre Trachten nur an, damit Touristen kämen.
Die ganze Insel ist wie ein großer Garten: viele kleine, gepflasterte Wege zwischen Gartenzäunen laufen auf Terassen kreuz und quer, so dass er schwer fällt, die Richtung einzuhalten. Die Höfe sind ziemlich ärmlich: ein zweistöckiges schmales Haupthaus und die Küche ohne Kamin daran gebaut. Die Frauen haben verquollene Augen, wenn sie gekocht haben. Je nach Reichtum sind sie mit Wellblech oder mit Schilf gedeckt. Es gibt auch eine Adventisten-Kirche, wohl nach dem Motto: Wer zuerst da ist…
Wir unterhalten uns mit dem einzigen Ladenbesitzer, dessen Inventar mit deutscher Hilfe eingekauft worden ist. Später klärt uns der señor auf, dass der Laden comunal sei.
Das ist auch der Unterschied zu den Orten in der Sierra und auf dem Altiplano: Um überhaupt in den Geldverkehr eintreten zu können, müssen die Leute gemeinsam handeln. Je 30 besitzen ein Boot. Gemeinsam tauschen sie das steinharte Eukalyptusholz gegen Lebensmittel. Außerdem handeln sie mit den Urus.
Der Laden ist sinnvoll, weil die Armen die Schiffspassage nach Puno gar nicht aufbringen könnten. Wir könnten für den Ladenbesitzer „Schicksal“ spielen, indem wir irgendwelchen Reiseführern [damals gab es noch keine außer dem South American Handbook] mitteilten, dass er auch ein alojamiento hat, was bis jetzt [1984] niemand weiß.
Die Situation ist vielleicht untypisch. Früher haben nur 900 Leute auf der Insel gelebt, und vermutlich hat erst der Handel mehr ermöglicht. Die Leute auf Amanataní seine fleißig. (…)
Alle Kinder rufen ständig da me plata (gib mir Geld), weil irgendwelche Touristen ihnen wohl für Weg- und andere Auskünfte etwas bezahlt haben. Die ersten Touristen, Franzosen – vor ca. zwei oder drei Jahren -, haben mit ihren blonden Haaren noch die Kinder erschreckt.
Die Rückfahrt ist schrecklich: ziemlich hoher Wellengang, und mir ist kotzübel, was sich nach einer Weile ein wenig bessert. Ein Kotzeimer wird auf dem Boot herumgereicht, und ich muss die ganze Zeit kacken, was die Neugier auf die Urus, bei denen wir anlegen, vermindert. Eine „Herde“ von Schilfbooten empfängt uns und cargo wird umgeladen. Ich weiß nicht, ob die Urus nur von Fisch leben?
Aguas Calientes
Fotografiert am 25.03.1984 in Chivay, Peru. Chivay ist bekannt für heiße Quellen. (Leider ist das Foto von mir ein bisschen verwackelt.)















































