Arequipa oder: are quepay!
Arequipa (Peru), die „weiße Stadt“, das Zentrum des Südens – die Altstadt ist Weltkulturerbe.
Wenn man das obere Foto genau betrachtet und es mit der Perspektive von heute vergleicht, erkennt man, dass der Riss im Bogen, der vermutlich von einem der zahlreichen Erdbeben in der Region stammt, ausgebessert zu sein scheint. Damals habe ich mich kaum getraut, darunter herzulaufen. Von wo aus ich damals den Plaza Mayor fotografiert habe, konnte ich nicht genau ermitteln; ich muss wohl irgendwo im 1. Stock der Bogengänge gestanden haben.
Aus meinem Reisetagebuch, auch über das Monasterio de Santa Catalina, März 1984:
In Arequipa waren wir sieben Nächte, vor allem wegen B.s Durchfall, der jetzt [21.3.] endgültig vorbei ist. In Arequipa fällt mir zuerst das Frauenkloster ein. Der Konvent war auch das einzige, was wir außer einem kurzen Blick in die Kathedrale, wirklich besichtigt haben. Das Kloster ist wie eine Miniaturstadt mit offenbar streng geregelten Möglichkeiten, mit der Außenwelt Kontakt aufzunehmen. Doppelt holzvergitterte Fenster sind die einzige Sprechmöglichkeit mit Besuchern. Der Gang innen nach oben ist mit durchsichtigen Steinen versehen, da dass Tageslicht hereinkommen kann.
Die ganze „Stadt“ mit kleinen Straßen und Plätzen gliedert sich in zwei Abteilungen, die für die jungen Nonnen, in der das meiste gemeinsam gehalten ist (Schlafsaal, Küche) und eine für die sozialen Aufsteigerinnen mit eigenem Zimmer und einem für Bedienstete. [Im Kloster lebten rund 400 Nonnen. Es wurde erst 1970 zum ersten Mal der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.]
Originell sind die riesigen, auf die Hälfte verkleinerten Weinkrüge (?! zum Waschen. Außerdem gibt es in einem Café des Klosters leckeren Kuchen, untermalt mit den Brandenburgischen Konzerten – das ist natürlich eine Konzession an die Touristen.
Wenn man sich vorstellt, dass das Kloster die einzige Gelegenheit für Frauen war, aus der Gesellschaft „auszubrechen“, hat es eine ähnliche Funktion wie ein heutiges Frauenhaus. [Dem Vergleich würde ich heute nicht mehr ziehen.] Dafür spricht auch die Marienverehrung, demgegenüber Jesus ziemlich schlecht abschneidet.
Das Hotel Tradition, in dem wir waren [Calle Sucre, das scheint nicht mehr zu existieren, vgl. Foto unten der Hof, oben meine damalige Freundin], war aber auch nötig. Heißes Wasser und ein sauberes Klo! Wenn wir gewusst hätten, was uns danach erwartete [ich hatte das in Chivay im Valle de Colca geschrieben, ca. eine Woche nach dem Aufenthalt in Arequipa], hätten wir das noch mehr zu schätzen gewusst.
Fast jeden Tag gehen wir in den einzigen Gringo- und Bonzentreff, den „Grill“ einer alten Schweizerin [am Hauptplatz], die ziemlich rassistisch denkt. Die „kleinen Dunklen“, die alles „nebeneinander“ machten, mag sie gar nicht. Es gibt Apfelstrudel, silbernes Besteck und Porzellangeschirr, aber dafür reißt sie einem auch alles wieder aus der Hand, kaum dass man fertig ist. Das Lokal besteht fast nur aus Einrichtungsgegenständen, die wohl noch aus den 40-er Jahren stammen: Ein Plakat der V. Olympischen Winterspiele, ein von einer kleinen antiken Wandleuchte bestrahlter Alphornbläser und natürlich der Schweizer Fahne. Ambulantes und Bettler werden nicht hineingelassen.
Das Wichtigste in Arequipa war der Markt mit einer der größten Markthallen, die ich je gesehen habe. Wir probieren jeden Tag jugos, unter anderem von manzanas, der aber natürlich wie süßes flüssiges Apfelmus schmeckt. Außerdem trinken wir literweise Coca-Tee, der aber so ähnlich wie jeder andere Tee wirkt und schmeckt.
In Arequipa fallen mir die vielen Bettler auf, viel mehr als in Lima. Der Übergang zum fliegenden Händler ist fließend. So etwa wie die Losverkäufer, die im Rollstuhl sitzen oder mit epileptischen Zuckungen noch etwas verkaufen wollen.
Das bemerkenswerteste Erlebnis, bei dem ich noch mächtig stolz auf mich war, war der geglückte und doch nicht geglückte Taschendiebstahl. Im totalen Gedränge wurde B. von zwei Kerlen zusammengequetscht und bemerkte plötzlich, dass ihr Portemonnaie in der Beintasche [der Cargo-Hose] fehlte. Zum Glück war es nur unser „Diebesgeld“* und nur ein paar Dollar darin. Wir merkten aber, wer es gewesen war, weil der Typ abflitze – und ab in die Markthalle.
Ich rannte hinterher. Am Eingang riefen schon die Marktfrauen arriba! [Er ist oben!] Ich nahm die Empore von der anderen Seite, sah auch den Kerl, der, als er mich erblickte, die Treppe wieder hinunterstürzte. Ich hinterher, quer durch das Gemüse, bis ich ihn schnappte. Zufällig stand ein Polizist daneben, der aber nur mit seiner Pfeife trillerte, mir aber ansonsten das Feld überließ und nichts tat.
Nachdem ich auf’s Geratewohl behauptet hatte, in dem Portemonnaie seien 5.000 Soles gewesen [damals weniger als ein Dollar] und eine drohende Haltung einnahm, rückte der Kerl 5.000 Soles heraus – das waren aber nicht die unseren. [Der andere Dieb hatte Geld und Portemonnaie; dieser hatte mich nur ablenken wollen, indem er wegrannte.] So retteten wir immerhin plus minus Null, obwohl ich gern das Gesicht des Typen gesehen hätte, wenn der später versuchte, die Lira in einer Bank einzuwechseln. Das Portemonnaie haben sie vielleicht auch zu verkaufen versucht.
Auffallend am Markt ist der starke „indianische“ Einschlag, mehr auf den Straßen rund um den Markt. Jede „Berufsgruppe“ hockt zusammen, Fleisch, Fisch, Gemüse, Obst, Coca, Kräuter, Nähmaschinen, die wie in einer frühkapitalistischen Manufaktur gemeinsam rattern, Eisen, Krimskram, Plastik, bäuerlicher Bedarf, Schuhe.
In Arequipa ist sonst nicht viel los [1984!]. Wir gehen um neun ins Bett. Morgens können wir den Misti sehen und noch eine schneebedeckte Bergkette. Bei schönem Wetter – es soll nur fünf Regentage im Jahr geben, die wir fast alle erwischt haben – muss die Aussicht toll sein.
In den Zeitungen steht viel über den Generalstreik am 23. März. Vom Hotel aus sehen wir sogar keine kleine Männer-Demo, die, die Reihen fest geschlossen, zum paro nacional aufruft. Der soll aber laut Auskunft des Touristenbüros nur 24 Stunden dauern. (…)
Am Sonntag – der Hotelseñor leiht uns noch seinen Wecker – marschieren wir zur Jacantaya-Busgesellschaft am Busbahnhof und fahren nach Cabanaconde.
_____________________________
*Ich hatte bei jeder Reise ein kleines Portemonnaie mit ein paar Dollar und großen, aber wertlosen italienischen Lira-Scheinen dabei. Falls ich überfallen worden wäre, hätte ich das herausgerückt. Alles andere Geld war im Geldgürtel – so etwa kannte kaum jemand in Südamerika – oder woanders versteckt.
Kommentare
One Kommentar zu “Arequipa oder: are quepay!”
Schreibe einen Kommentar






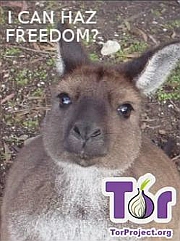



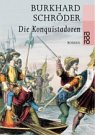

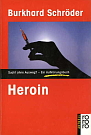
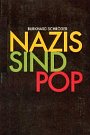





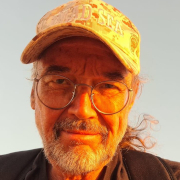

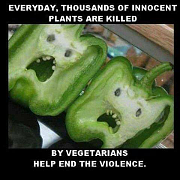

[…] Nachrag zu Cabanaconde, damals noch ein winziges Bauerndorf, eine Tagesreise nördlich von Arequipa, in den peruanischen Anden (1984). Mehr Fotos im April 2011: “Valle de […]