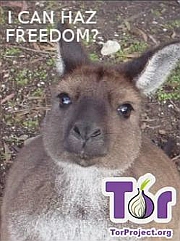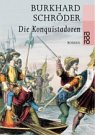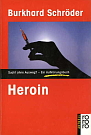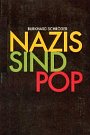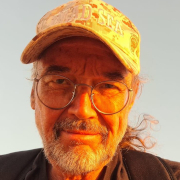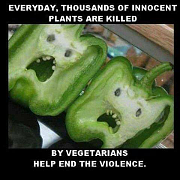Kapitalismus 2.0
Dieser Artikel erschien leicht verändert am 08.02.2008 unter dem Titel „Virtuelles Geld, reale Banken – und umgekehrt“ in der Netzeitung.
Es ist nicht immer eine Bank, wenn Bank draufsteht. Das mussten viele Nutzer der digitalen Welt Second Life schmerzlich erfahren: Gingko Financial, die bekannteste „Bank“, löste sich im September spurlos auf. 200 Millionen der Second-Life-„Währung“ Lindendollar waren weg – umgerechnet eine halbe Million Euro Einlagen. Der Gingko-„Banker“ Andre Sanchez alias Nicholas Portocarrero alias Michael Pratte konnte nicht belangt werden. Ein virtueller Schwarzer Freitag also? Nein: Reale Banken funktionieren in virtuellen Welten genausowenig wie die realen Marktgesetze. Das hindert Linden Lab, die Betreiberfirma von Second Life, dennoch nicht daran, mit seinen „Economic Statistics“ das Gegenteil zu suggerieren.

In Second Life kann man reales Geld ausgeben, etwa für den Kauf eines virtuellen Grundstücks, die dafür fällige monatliche „Steuer“ an Linden Lab, für die Textilien des Avatars, für Genitalien oder für Dienstleisungen wie Cybersex. Reale Dollar müssen dafür in Lindendollar umgetauscht werden. Das geht – mit wenigen Ausnahmen – nur über eine Kreditkarte oder ein Konto bei Paypal. Jeder Avatar trägt seine virtuelle Geldbörse immer bei sich, ohne dass sie in Gefahr wäre gestohlen zu werden oder an Wert verlöre.
Der Lindendollar ist jedoch trotz seines „Wechselkurses“ keine Währung, sondern nur ein Micropayment-System mit einem willkürlich von Linden Lab festgesetzten Wert, vergleichbar mit Microsoft Points, einer Verrechnungseinheit, mit der man zum Beispiel für den MP3-Player Zune Songs kaufen kann. Niemand braucht daher Banken in Second Life. Auch die „Börse“ in Second Life verschwand schon nach kurzer Zeit wieder im Nirwana.
Avatare können keine Verträge miteinander abschließen, die einklagbar wären, ohne den realen Menschen hinter der virtuellen Maske identifiziert zu haben. Die Nutzer in Second Life dürfen fast alles tun, solange keine ernsthaften Beschwerden laut werden. Sie können andere betrügen, sich Vertrauen erschleichen und Lindendollar zu Wucherzinsen verleihen wie im Mittelalter.

Second Life ist aber keine Simulation der Welt, sondern imitiert nur bestimmte Aspekte der Realität. Niemand kann bei Streitfällen ein Gericht anrufen. Es gibt keinen Krieg: Politik kann nicht mit anderen Mittel fortgesetzt werden. Die Ökonomie stagniert nur auf dem Niveau eines Pfandleihhauses. Noch nicht einmal die Wirtschaft Venedigs in der Renaissance könnte realistisch nachgespielt werden, obwohl der reale Umsatz in und mit Second Life das Bruttosozialprodukt von Guinea-Bissau übersteigt. In der vituellen Welt gibt es weder Gewalt noch Diebstahl. Die wenigen Hacker-Angriffe auf das Hab und Gut der Avatare nutzten Lücken in der Zugangssoftware aus, die Linden Lab bekannt waren, aber nicht rechtzeitig oder aus Prinzip nicht geschlossen wurden – wie die Möglichkeit, Avataren, die fahrlässig Land weit unter dem üblichen Preis anbieten, ihr Territorium durch eine speziell programmierte Software („Bots“) wegzunehmen.
Es gab daher auch keine virtuelle Bankenkrise. Das Vermögen der so genannten virtuellen Geldinstitute war immer „Fiat money“ – ein Begriff aus der Volkswirtschaftslehre für Geld, das nicht oder nur teilweise durch reale Werte gedeckt ist. Die „Banken“ konnten sich nur etablieren, weil die Betreiber Zinsen bis zu 40 Prozent versprachen, also Gutgläubige fanden, die an eine Art wundersame und magische Vermehrung des Lindendollar glaubten. Auch in der realen Welt findet so etwas immer wieder statt, bis hin zu Pyramidenspielen und schlichter Abzockerei.

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Linden Lab wären nach deutschem Recht ohnehin nichtig: Die kalifornische Firma behält sich vor, ihre Kunden jederzeit ohne Angabe von Gründen enteignen zu können – ohne sie dafür zu entschädigen. Linden Lab finanzierte seine 3D-Welt vor allem durch Risikokapital des Investors Benchmark Capital, will aber selbst kein Risiko eingehen und hat sich juristisch ungefähr den Status eines mittelalterlichen Raubritters gesichert. Keine deutsche Bank betreibt ihr ureigenstes Geschäft unter solchen Bedingungen.
Ab dem 22.1.2008 dürfen nur noch virtuelle Banken in Second Life ihre Dienste anbieten, die auch eine Lizenz im realen Leben vorweisen können. Dubiose „Firmen“ wie die Royal Bank of Whitfield – im Besitz eines deutschen Nutzers – oder die „Thomas Bank Deutsche Branche“ sind verschwunden. Nur die „Q110 Deutsche Bank“ ist virtuell präsent – mit einer Filiale, die der realen in der Friedrichstraße in Berlin-Mitte nachgebaut ist. Das auf sechs Monate befristete Projekt soll als Test dienen, sich mit virtuellen Welten zu befassen, wie die Besucher die „Q110 Deutsche Bank“ wahrnehmen und was sie davon erwarten. „Das Ziel war es nicht, reale Konten anzubieten“, sagt der Avatar Hedge Koenkamp alias Oliver Ehrhardt im realen Leben. Die Filiale ist ein Pilotprojekt für die gefühlte „Bank der Zukunft“. Der Geldautomat der virtuellen Deutschen Bank macht etwas, wovon man in der Realität nur träumen kann: Er spuckt nach dem Zufallsprinzip fünf Lindendollar (0,01 Cent) an Avatare aus – ein Bonsai-Glücksspielautomat in pseudo-seriösem Outfit, den man in der realen Filiale der Deutschen Bank vergeblich sucht.
Auf den „Gelben Seiten“ von Second Life finden sich dennoch zahlreiche Banken, als verlangten die Nutzer, dass ihnen das, was virtuell nicht funktioniert, immerhin vorgegaukelt wird. Das New Yorker Unternehmen Coldwell Banker zum Beispiel besitzt eine – mittlerweile stark eingedampfte – virtuelle Niederlassung. Das Unternehmen ist aber keine Bank, sondern handelt vornehmlich mit Immobilien, die man auch virtuell begutachten konnte. Man kann dort Lindendollar auf ein Konto einzahlen, eine Art Pfand für den Kauf einer virtuellen Immobilie, das man ohne Zinsen nach einer Frist zurückbekommt. Auch das ist kein normales Bankgeschäft.

Einige Geldinstitute in Second Life sind seriös, aber trotzdem keine Bank. Sie nutzen die Tatsache aus, dass es schwierig ist, ohne Kreditkarte an das virtuelle „Spielgeld“ heranzukommen. Wer Lindendollar etwa bei ebay ersteigert, geht das Risiko ein, sein Vermögen sofort wieder zu verlieren, wenn sich herausstellte, dass es der Verkäufer mit einer gestohlenen Kreditkarte oder auf eine andere Art missbräuchlich erworben hat. Das deutsche Unternehmen Wirecard bietet eine Art virtuelle Prepaid-Mastercard an, die man bis zu einer gewissen Summe auch bar bei einer Bank auffüllen kann. Ohne PostIdent-Verfahren hat der User kein normales Girokonto, sondern ein eGeld-Account. Auch der Telelinden Cash Service aus Germering bei München offeriert, ohne Konto und Kreditkarte Lindendollar erwerben zu können.
Der „Bankencrash“ von Second Life beweist vor allem eines: Vertrauen in ein Geldinstitut ist gut, aber nur für das Institut, nicht für den Kunden. Kontrolle der Bank wäre besser, aber nicht von einem Raubritter, sondern von einer Bankaufsicht. Man darf gespannt sein, wie Linden Lab reagierte, wenn eine Bank mit staatlicher Lizenz aus Nigeria oder aus Angola eine virtuelle Niederlassung eröffnete.

„Andre Sanchez“, den ich noch im Artikel in der Netzeitung erwähnte, existiert vermutlich nicht, vgl. die ausführliche Diskussion über die wahren Hintermänner der „Ginko Financial“ auf virtuallyblind.com (Benjamin Duranske, 13.08.2007):
„The reason I haven’t run this info on VB up to now is that I had — so far — been fairly convinced that the registrant, Michael Pratte, though affiliated with Ginko and someone who took money from it, was not the person who controls the ‘Nicholas Portocarrero’ avatar. I’ve known I could be wrong on this point, but I was never sufficiently convinced otherwise to run the data identifying Pratte. That all said, I’m intrigued by the above poster’s (confirmed) point that ginkosoft.com was registered in 2000 (well before Second Life was created).
That has to mean either:
1) Andre Sanchez (who controls the avatar ‘Nicholas Portocarrero’) met a guy in Second Life in early 2005 who already had a domain. Under this theory, I’m guessing the guy is ‘Hinoserm Rebus,’ Ginko’s technical guy, and an avatar probably controlled by Michael Pratte. That guy — Pratte/’Rebus’ (or some other avatar we don’t know about) owned a website called “ginkosoft.com” already, and he and Sanchez decided to name the bank “Ginko” because the site wasn’t being used for anything. They then bought ginkofinancial.com (in 2005), and Pratte/’Rebus’ (or whoever) registered that one too.
or…
2) There is no “Andre Sanchez” and the guy who owns both domains — Michael Pratte — ran Ginko and controls both the ‘Portocarrero’ and ‘Rebus’ avatars. If the second of the above options is true, and this whole story (Nicholas being inspired by a famous banker, etc.) is completely phony from the beginning, then it’d be pretty hard argue this wasn’t actually set up as a scam from day one. Also, for what it’s worth, it would be a lot easier to sue a guy who is in the U.S. (if Pratte… is Hinoserm… is Nicholas — he is now in Texas according to the Official Ginko Blog) than a guy in Brazil.“
Kommentare
Schreibe einen Kommentar